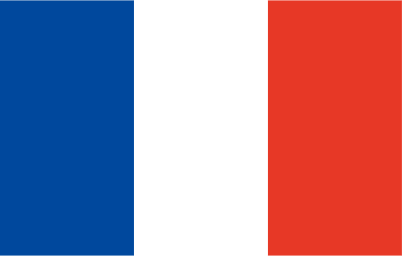EMV bei Frequenzumrichtern: Störungen erkennen und vermeiden
Frequenzumrichter sind in der modernen Automatisierungs- und Antriebstechnik unverzichtbar, da sie die flexible Regelung von Drehzahlen ermöglichen. Doch mit ihrer Verbreitung rückt ein Thema immer stärker in den Fokus: die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Frequenzumrichter können erhebliche elektromagnetische Störungen (EMI) verursachen, die andere Systeme beeinflussen oder sogar lahmlegen. Um Produktionsausfälle und Sicherheitsrisiken zu vermeiden, ist es entscheidend, EMV-Störungen frühzeitig zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
Störungen erkennen – wie äußern sich EMV-Probleme?
EMV-Störungen treten oft diffus auf. Typische Anzeichen sind unklare Fehlermeldungen an Steuerungen, flackernde Anzeigen, instabile Sensorwerte, Kommunikationsprobleme zwischen Geräten oder unerklärliche Stillstände von Antrieben. Solche Phänomene sind nicht nur schwer zuzuordnen, sondern auch meist sporadisch – was die Fehlersuche erschwert.
Die Ursache liegt häufig im schnellen Schaltverhalten der Leistungselektronik im Frequenzumrichter. Dabei entstehen hochfrequente Spannungs- und Stromimpulse, die über Kabel als Störsignale abgestrahlt oder als Gleichtaktströme in das System eingekoppelt werden. Ungünstige Erdungs- oder Abschirmkonzepte können diese Effekte zusätzlich verstärken.

Störungen vermeiden – praktische EMV-Maßnahmen
Um elektromagnetische Störungen wirkungsvoll zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Installation unerlässlich. Bereits bei der Auswahl des Frequenzumrichters sollte auf integrierte Netzfilter geachtet werden. Diese reduzieren die Störemissionen erheblich und erleichtern die Einhaltung von EMV-Richtlinien.
Eine saubere Trennung von Leistungs- und Steuerleitungen ist ebenso wichtig wie deren richtige Verlegung. Steuerleitungen sollten möglichst weit entfernt von Leistungsleitungen verlaufen und abgeschirmt sein. Die Schirmung muss beidseitig niederimpedant geerdet werden, idealerweise auf einer großflächigen leitenden Fläche wie einer Montageplatte.
Auch die Erdung selbst spielt eine zentrale Rolle: Alle Geräte müssen sternförmig und mit geringem Widerstand an ein gemeinsames Erdpotential angeschlossen werden. Potenzialunterschiede zwischen Erdungspunkten sind zu vermeiden, da sie Störungen verstärken können.
Ein weiterer Hebel zur EMV-Optimierung liegt in der Einstellung der Taktfrequenz des Frequenzumrichters. Höhere Frequenzen ermöglichen zwar eine feinere Ansteuerung des Motors, erzeugen jedoch mehr hochfrequente Störungen. Hier gilt es, einen sinnvollen Kompromiss zwischen Motorperformance und EMV-Verträglichkeit zu finden.
EMV-Störungen bei Frequenzumrichtern sind kein Randproblem, sondern ein zentrales Thema in der industriellen Automatisierung. Wer elektromagnetische Störungen frühzeitig erkennt und gezielt vermeidet, sorgt nicht nur für einen stabilen und störungsfreien Betrieb, sondern erhöht auch die Lebensdauer und Verfügbarkeit der gesamten Anlage. EMV beginnt nicht erst bei der Inbetriebnahme – sondern bereits bei der Planung.
Zurück:Tipps zur Kühlung und Strombegrenzung bei Schrittmotortreibern
Next:Wartungstipps für Planetengetriebe mit Servomotor